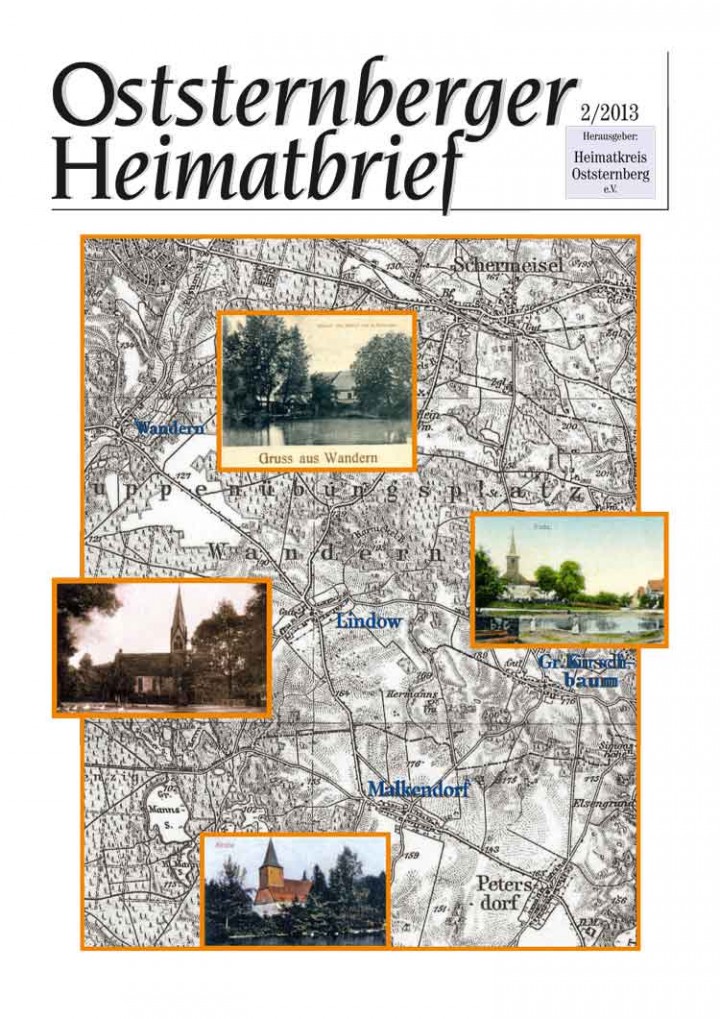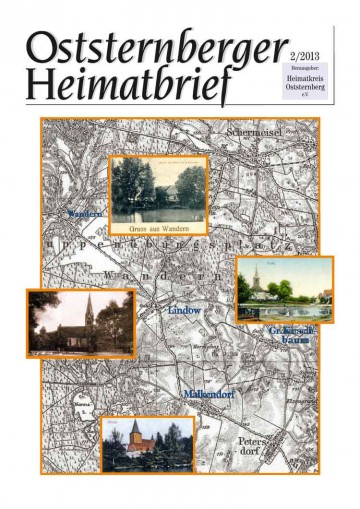Kurzes von 0-18 – von Dr. Werner Ende
SABINE.
„Kennen Sie die Neumark?” Wenn man jemanden diese Frage stellt, kommt meistens nur ein Achselzucken als Antwort. Ein junger Mensch kann es auch nicht wissen, denn er müsste schon die Landkarte des Deutschen Reiches vor dem Zweiten Weltkrieg vor Augen haben. Aber so meine Generation, glaube ich zumindest, sollte schon davon gehört haben. Habt ihr denn im Geschichtsunterricht nicht gelernt, dass Friedrich der Große im Siebenjährigen Krieg 1759 in Kunersdorf so erbärmlich die Schlacht verloren hat? Kunersdorf und Zorndorf, große Schlachtfelder in der Mark Brandenburg, im östlichen Teil der Mark? Das ist die Neumark. Die westliche Grenze Deutschlands kennt jeder; da fließt der Rhein, da liegen große Städte, wie Trier, Aachen oder Saarbrücken. Aber im Osten? Die Oder ist noch ein Begriff, vielleicht auch die Stadt Frankfurt. Aber wer weiß schon, dass ein von Osten kommender Fluss, die Warthe, bei Küstrin in die Oder fließt. Küstrin ist eine nicht kleine Festungsstadt. Hier hat Friedrich der Große als junger Leutnant im Knast gesessen, weil er seinem despotischen Vater entfliehen wollte. Heute hört Deutschland hier auf, aber nicht in den Jahren bis 1945. Da gab es auch Deutschland jenseits der Oder, oben im Norden Pommern, unten im Süden Schlesien und zwischen den beiden in der Mitte, da lag die Neumark. Gen Osten reichte sie nur 40–50 km ins Land, dann kam also wirklich Polen. Grenzstädte zu Polen kennt heute niemand mehr. Wer weiß schon, dass da die Stadt Schwerin lag; es reicht, wenn man das Schwerin in Mecklenburg kennt. Die ganze Region ist auch uninteressant, hat nicht Schlösser und Burgen zu bieten, der Boden ist sandig und wenig ertragreich. Und doch ist die Landschaft schön: große Wälder im hügeligen Gelände, dazwischen immer wieder kleine und große Seen. Es gibt keine Industrie, die Neumark wird von der Landwirtschaft beherrscht. So wohnen die Menschen also zum größten Teil in Dörfern, in einstöckigen Häusern.
Eines dieser Dörfer heißt Ögnitz. Davon soll hier erzählt werden und von meiner Familie, deren Vorfahren schon mehr als 100 Jahre hier oder in den Nachbardörfern lebten. Unser Dorf ist nicht groß, hat etwas über 600 Einwohner, eine Kirche, eine 2-klassige Schule, aber keine befestigten Straßen. Mitten im Wald gelegen, scheint es von der Außenwelt fast abgeschnitten. Die von Küstrin durch die Neumark fahrende Kleinbahn berührt das Dorf nicht; das Nachbardorf ist viel größer und hat deshalb einen Bahnhof bekommen. Aber irgendwie wurden die 4 km immer überwunden. Die wichtigsten Verkehrsmittel waren das Fahrrad, Pferd und Wagen. Ein Pferd hatte jedes Haus, denn die Bewohner waren Landwirte. 
Der Vormittag war auch gelöst, da waren sie ja in der Schule. Aber der Nachmittag musste überbrückt werden. Wir hatten, wie alle Dorfbewohner, natürlich auch Pferd und Wagen. Und wir hatten sogar einen Willy, einen treuen Kerl für alle möglichen Arbeiten in Haus, Hof und Acker. Ihm wurde die Nachmittagsverantwortung zugeschoben. Mit angespanntem Pferd vor der Kutsche musste er auf dem Hof warten, bis meine Brüder aus der Schule kamen. Dann schnelles Essen, rauf auf die Kutsche und ab ging die Fahrt – den ganzen Tag durch Wälder und Flure, bis es dunkel war. Die erste Kutschpartie startete schon am 20. Oktober, so mehr aus Vorsichtsgründen. Aber am 21. wurde schon Ernst aus der ganzen Sache. Die Schulzen war den ganzen Tag im Haus, weil meine Mutter ein verdächtiges Ziehen im Bauch verspürte. Mittags schnell in die Kutsche und ab ging die Fahrt. Gegen 20 Uhr hat sich Willy mit den Jungs nach Hause gewagt. Aber Sabine war noch nicht da. Am 22. früh hat mein Bruder Paul gefragt, warum die Schulzen bei uns übernachtet hätte und nicht die paar Häuser weiter, wo sie ihre Wohnung hat. Meine Mutter meinte, das hänge mit den starken Abführmaßnahmen zusammen, die jetzt die Bauchschmerzen endlich lösen sollten. Die Geburt kam scheinbar in Gang. Die zugespitzte Situation brachte Willy auf den Plan. Zu allem Unglück kam Walter eine Stunde früher als Paul aus der Schule. Er musste sofort in die Kutsche und wurde bis Pauls Schulschluss schon mal im Dorf eine Stunde im Karree durch die Straßen gefahren. Nach der Rundfahrt hat Willy gleich vor der Schule gehalten und Paul dann aufgeladen. Aber das war alles umsonst; als die Kutsche abends gegen 1/4 8 Uhr auf den Hof fuhr, war Sabine eben nicht geboren. Mein Vater wurde zum Lehrer geschickt, damit der erfuhr, warum Schularbeiten zurzeit nicht möglich wären. Man wusste ja nicht, wie oft die Landpartien noch erforderlich wurden. Er hat meinem Vater übrigens gesagt, dass die Kutschenidee ziemlich blödsinnig sei. Dorfkinder haben x-mal gesehen, wie Ferkel und Kälber auf die Welt kämen und da würden sie selber auf Menschen schließen. Das stimmt sicherlich nur bedingt. Für derartige Aufklärungsideen war die damalige Zeit bestimmt noch nicht reif. Viel erstaunlicher ist, dass die 2 Jungs nicht mal gefragt haben, was die dauernde Rumfahrerei mit Pferd und Wagen auf sich hätte. Vielleicht haben sie auch gefragt; was Willy ihnen erzählt hat, weiß niemand.
Nun kam die Nacht zum 23. Oktober, die Schulzen im Haus und Weh und Klagen im Schlafzimmer. Die Jungs schliefen wirklich fest und bekamen – angeblich – nichts mit. Die Schulzen war die ganze Nacht auf den Beinen. Schweißgebadet hat sie am Morgen des 23. Oktober das Handtuch geworfen. Unsere Familie gehörte im Dorf zu den drei Auserwählten, die ein Telefon besaßen. Gegen 6 Uhr früh hat sie die Kurbel des an der Wand hängenden Apparates gedreht. Der Doktor und Geburtshelfer aus der nahegelegenen Kleinstadt sollte zu Hilfe kommen. Er kam, auch mit Pferd und Wagen; meine Brüder waren gerade weg zur Schule. „Ja, ja”, meinte der Doktor, „Mädchen putzen sich erst, das dauert immer etwas länger.” Aber er war tatsächlich ein guter Geburtshelfer; 10.45 Uhr konnte das Neugeborene entwickelt werden. Und das vor Schulschluss, meine Eltern und Willy waren erleichtert. Die Anwesenheit des Doktors, der ja wegen der immer schwerer werdenden Krankheit der Mutter gerufen worden war, bot sich nun als Lösungskatalysator für das 2. Problem an; woher ist das Kind plötzlich gekommen. Man hat meinen Brüdern tatsächlich erzählt, dass der Doktor auf seinem Weg nach Ögnitz ein Kind im Graben liegen sah; durch das Schreien des Kindes habe das Pferd sogar gescheut. Ein Findelkind also. Der Doktor sei der Ansicht, dass es bei Endes sicherlich bleiben dürfe und dort mit 2 Jungs aufwachsen könnte. So habe er es mitgebracht. Die Mutter sei nun von ihrer Krankheit erlöst und aus Dankbarkeit wolle sie das Kind schon behalten.
So alles geschehen am 23. Oktober 1929. Ein ganz kleines Problem gab es am Schluss doch noch,” aber das weiß jeder: Sabine heißt ja Werner.
Das erste Kapitel aus dem Büchlein von Werner Ende.