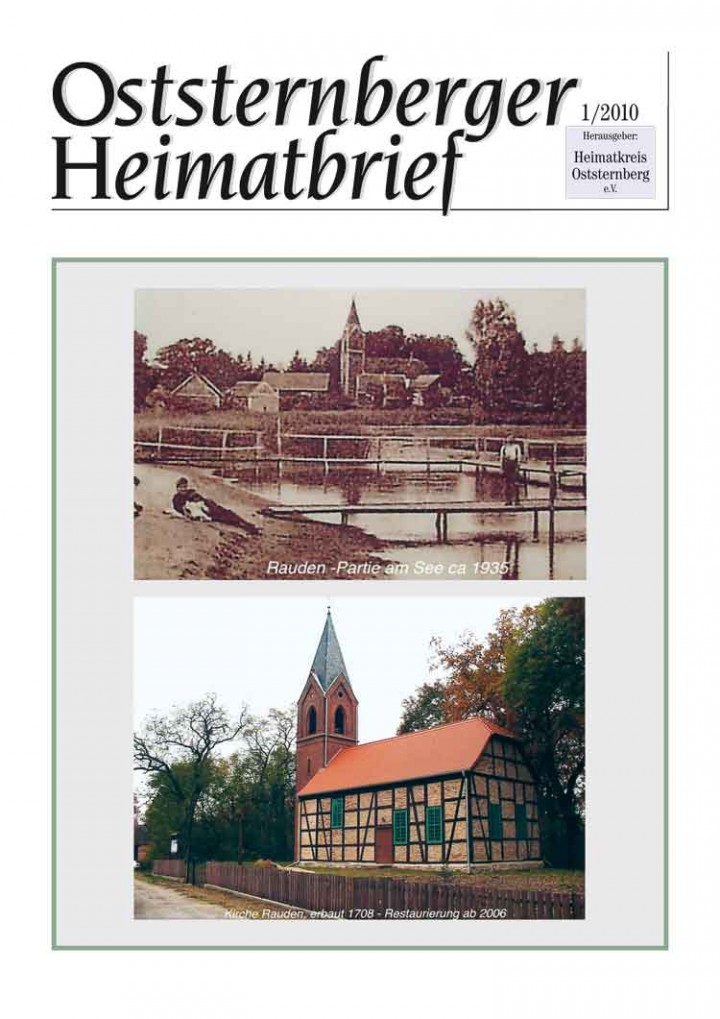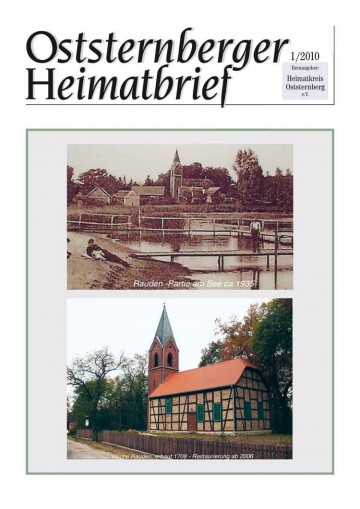Erinnerungen an Priebrow
Sommerabend in Priebrow
Letzte Gespanne kehren vom Heuen aus den Wiesen zurück ins Dorf. Die Hausfrauen waren schon früher mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, um zu melken und das Abendbrot vorzubereiten. Eine Duftwolke von frischem Heu, gebratenem Speck mit Zwiebeln durchzieht das Dorf. Das Muhen der Kühe nach Tränkung mischt sich mit dem Klappern von Milchkannen.
Nach Arbeitsende sitzen die Familien um den Abendbrottisch. Speckeierpfannkuchen, Bratkartoffeln, Brot mit Butter und Wurst sind beliebte Abendmahlzeiten. Dazu wird Milch oder Malzkaffee getrunken. Blieb die Familie über Mittag in den Wiesen, gab es die Hauptmahlzeit am Abend.
Im Dorf ist Ruhe eingekehrt. Die Störche sind auf ihr Nest zurückgekehrt und haben das Klappern eingestellt. Manchmal hört man das Dengeln einer Sense. Die Frösche in den umliegenden Gewässern beginnen ihr Konzert, das wie eine Wolke das Dorf umhüllt. Dazwischen ist der dumpfe Ruf der Rohrdommel zu hören.

Fotos: Stefan Wiernowolski
Nach heißen Sommertagen treffen wir Kinder und ältere Jugendliche uns zum Baden am Ledling. Laut geht es dabei zu. Das Lachen und Kreischen ist bis ins Dorf zu hören. Erst die einbrechende Dunkelheit beendet unseren Badespaß.
Nach kühleren Tagen treffen wir Kinder uns abends auf der Dorfstraße, um Völker- oder Treibeball zu spielen. Zwei ältere und bessere Spieler suchen ihre Mannschaft aus. Jeder versuchte die besten Spielerinnen und Spieler in seine Gruppe zu bekommen. Ich zählte zu den schlechteren Spielern. Beim Völkerball konnte ich nicht gut fangen, bei Treibeball nicht weit genug werfen. Wir spielten, bis die ersten von uns ins Haus gerufen worden.
Manchmal habe ich nach dem Spielen Aalschnüre gelegt. Die Tauwürmer dafür hatte ich abends mit der Stalllaterne gesucht und in einer alten Zinkwanne mit lockerer Erde bereit gehalten. Großvaters Hof lag direkt am Flussufer. Vier Kähne waren dort an einem alten Stubben angekettet. Ruder und Fischerstangen standen zwischen zwei Ulmen. Zu den Fischgründen war es nicht weit. Nach dem Legen der Aalschnüre schlief ich in Großvaters Zimmer. Dort war immer ein Bett für mich frei. Im Morgengrauen rief Großvater: „Junge, du musst raus.“ Die Schnüre mussten vor Tagesanbruch eingeholt werden, um den Aalen die Möglichkeit zum „Abdrehen“ zu nehmen. Gefangene Aale kamen in den Fischkasten in der Strommitte. Dort wurden sie bis zum Verbrauch mit anderen Fischen gehältert. Es gab auch Nächte ohne Fang. Nach dem Einholen der Schnüre gab es noch einen kurzen Schlaf. Dann ging ich nach Hause zu meinen Eltern nach Sonnenburg zum Frühstück und danach zur Schule.
Bittere Lehre
Der Fluss, Strom genannt, floss an der Rückseite des Hofes meines Onkels vorbei. Er gehörte zu den Flussarmen des Warthedeltas. Da meine Eltern nur 15 Gehminuten entfernt von hier in Sonnenburg wohnten, war ich sehr oft im Hause meines Onkels und meines Großvaters.
Mein Onkel war Landwirt und Fischer. Auf seinem Hofe ruhte ein Fischereirecht. So war es ganz natürlich, dass ich eher einen Kahn staken und schwimmen konnte als lesen und schreiben. Mein Großvater lebte als Altenteiler auf dem Hofe. Er war Landwirt, Fischer und Jäger gewesen. Er leerte mich das Angeln, mein Onkel das Fischen mit Netzen. Ich verbrachte manche Stunde am Strom beim Angeln von Plötzen, Rotfedern, Barschen, Bleien, Aalen und Hechten. Besonders das Hechtangeln brachte mir den größten Spaß.

Zum Fang von Köderfischen hatte ich eine zweite Rute mit einer Angel aus Sehne. Beide Ruten waren immer einsatzbereit. Wann immer meine Zeit es zuließ, machte ich als Köder einen Teig aus Brot, suchte Sprock oder grub am Misthaufen Rotwürmer aus. Vom Kahn aus angelte ich Köderfische, kleine Plötzen oder Rotaugen. Es klappte fast immer. Mit einigen Köderfischen im Kahnfischfach fuhr ich zum Hechtangeln.
So auch an diesem Tage. Mit dem Kahn fuhr ich ein Stück stromab. Die Ufer waren beiderseits mit Weidendickicht bewachsen. Davor lagen Schilfgrasplaven und kleine Stellen mit Seerosen (Mummeln). Die kleinen Buchten dazwischen waren bevorzugte Hechtstandplätze. Ich ließ meine Angel meistens zwischen dem stehenden und dem fließenden Wasser einer solchen Bucht treiben. Mein Großvater hatte es mir so gezeigt und mancher gefangene Hecht hat die Richtigkeit dieser Methode bestätigt.
Etwa 4 Meter von einer Bucht in Richtung Strommitte entfernt, hatte sich an in den Grund gesteckten Fischerpfählen eine Menge bei Flussreinigung abgeschnittenen Schwanders und anderer Wasserpflanzen verfangen und einen halbkreisförmigen Wall gebildet. Links und rechts floß das Wasser schnell vorbei. Eine Kahnlänge stromab machte ich meinen Kahn fest am in den Grund gestoßenem Stakruder. Er stand im Strom wie eine Fahne im Wind. Jetzt schnell aus dem Kahnfischfach einen Köderfisch gegriffen, an den Drilling gehakt und mit guten Wünschen ins Wasser entlassen. Stromaufwärts neben dem Wall aus Wasserpflanzen habe ich den Köder eingesetzt und ungefähr 4 Meter vom Kahn abwärts treiben lassen bis zum Ende der Schnurreichweite. Das habe ich mehrmals wiederholt. Dann kam der Biss. Der Hecht zog stromaufwärts. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, anhauen! Der Haken hatte gefasst. Blitzschnell schoss mir die Mahnung meines Großvaters durch den Kopf: „Nicht besinnen lassen, ziehen, kräftig ziehen!“ Schon hatte ich die Rute Hand über Hand nach hinten weggeschoben und die Schnur in der Hand. Da besann sich mein Gegner auf seine Kraft. Peitschte wild das Wasser und lief im Schnurradius hin und her. Einen Moment hatte ich mit dem Schnureinholen angehalten, dann zog ich wieder Hand über Hand und sah ihn: Ein stattlicher Hecht, den Rachen weit aufgerissen zerrte und schüttelte er. Ich ging in die Knie und mit den Oberschenkeln an die Kahnwand. Mit weit vorgebeugtem Oberkörper zog ich die letzten Meter Schnur ein um den Hecht von unten, wie vom Großvater gelernt und schon öfter probiert, in die Kiemen zu greifen. Blitzschnell schoss der Hecht an einer griffbereiten Hand vorbei unter den Kahn. Nach einem Ruck an der Schnur war er weg.
Das lose Schnurende baumelte in der Strömung. Nachdem Schreck und Enttäuschung von mir gewichen war, merkte ich, dass ich die Schnur mit meinem Knie an die Bordwand gedrückt hatte. Daher der Ruck. Mit weichen Knien und ohne klare Gedanken löste ich meinen Kahn und stakte nach Hause. Meinen Großvater traf ich im Garten. Ich berichtete von meinem Pech. Er hörte mir zu und sagte nach kurzer Überlegung. „Zeig mir mal deine Angel!“ Er betrachtete die Bruchstelle der Schnur. „Ja“, sagte er, „du hast die Bleiolive zu lange an der gleichen Stelle gelassen. In ihrem engen Loch konnte die Schnur nie richtig trocknen und hat dadurch ihre Festigkeit verloren.“ Das war mir eine Lehre. Fortan habe ich vor jedem Angeln die Bleiolive und das Messingkettchen neu angebunden und immer einen Kätscher dabei gehabt. Außerdem habe ich gelernt, dass ein gehakter Hecht müde gedrillt werden sollte, ehe man ihn mit dem Käscher aus dem Wasser hebt.
Heuernte
Im Juni war die Zeit der Heuernte. Zu Großvaters Hof gehörten 32 Morgen „Lange Wiese“ und 10 Morgen Wiesenlos. Die „Lange Wiese“ war vor Generationen Torfabbaugebiet. Die ehemaligen Torfgruben waren zugewachsen und nur als flache Senken zu erkennen. Ihr Untergrund war nicht fest genug, um dort mit dem Pferdegespann und der Mähmaschine zu mähen. Dort musste das Gras mit der Sense gemäht werden. Am Wiesenrand gab es einen festen Weg, der mit dem Gespann und dem Wagen befahren werden konnte. Zum Trocknen wurde das Heu von Hand mit der Harke gewendet und dann zu kleinen Haufen, den Kapitzen zum Nachtrocknen zusammengetragen. Durch Unterschieben von zwei 
Das Heu wurde verfüttert oder an die Heupressen in Priebrow und Sonnenburg verkauft. Die Preise schwankten nach Jahresangebot und Qualität zwischen 1,50 RM und 3,00 RM pro Zentner. Für Samenheu gab es die besten, für Militz und Seggen die schlechteren Preise. Anfang der 30er Jahre fuhren 3 Priebrower Landwirte Heufuhren nach Frankfurt/Oder zum Proviantamt der Reichswehr, um dort bessere Preise zu bekommen. Es fuhren mein Onkel Albert Mierse, Wilhelm Ewald, und Albert Golze. Die Leiterwagen wurden hinten mit einer „Schwinge“ verlängert um mehr Laderaum zu bekommen. Ein Bindebaum wurde oben längs über die Fuhre mit Seilen festgezurrt zur Seitenstabilität. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zentner Heu geladen werden konnten. Onkel Albert nahm mich mit. Die Fahrt begann abends. Zur Beleuchtung hing eine Stalllaterne zwischen den hinteren Wagenrädern. Um den Pferden beim Anstieg auf dem Frauenhofer Berg Verschnaufpausen zu geben, war hinter jedem Hinterrad eine Rolle aus rundem Holz mit etwa 20 cm Durchmesser und 30 cm Länge beim Anstieg dicht hinter den Rädern hergezogen. Stirnseitig waren starke Nägel mittig in die Rollen bis auf 2 cm eingeschlagen. An 2 dicken Schnüren waren die Rollen rechts und links vom Rad an der Achse befestigt. Sie dienten so als Hemmschuh wenn die Pferde stehen blieben. Eiserne Hemmschuhe hatten wir nicht.
Frühmorgens erreichten nach etwa 35 km in Frankfurt das Proviantamt. Ein Unfreundlicher Verwaltungsoffizier prüfte die Heuqualität und beurteilte sie schlechter als erwartet. Onkel Albert hat als alter Weltkriegssoldat vor ihm „Haltung“ angenommen. Das hat mich sehr geärgert. Gegen Mittag fuhren wir zurück. In Frauendorf machten wir bei Verwandten von Albert Golze Mittagspause. Die Pferde wurden getränkt und gefüttert. Wir aßen Grützwurst mit Pellkartoffeln. Am Spätnachmittag waren wir wieder in Priebrow.
Fischverkauf
Fische wurden nur lebend angeboten. Vorwiegend waren es Hechte, Bleie, Jäsen, Rapfen, Plötzen, Aale und Schleien. Der Kunde wählte, der Fisch wurde gewogen, erst nach nach Kundenzustimmung getötet. Auf Kundenwunsch konnten jederzeit Fische aus den im Strom hängenden Fischkästen gekauft werden. Am Sonntagmorgen standen Fische in Hofwannen und Zubern auf dem Hof zum Verkauf. Gelegentlich wurden auch Fische, in ehemaligen Biertonnen gehältert, in den Nachbardörfern angeboten. Ich erinnere mich an eine Fahrt mit Onkel Albert zum Fischmarkt in Drossen. 2 Tonnen, bauchseitig mit viereckigen Ausschnitten versehen, wurden auf den Wagen geladen und an der Pumpe mit Wasser gefüllt. Dazu kamen Wanne und Zuber, die Waage und ein Kätscher. Vor 5 Uhr starteten wir, um gegen 8 Uhr in Drossen auf dem Fischmarkt zu sein. In Wanne und Zuber wurden die Fische angeboten. In einem Gasthof mit Ausspann stellten wir die Pferde unter und versorgten sie dort. Wenn gegen Mittag mit Glück alle Fische verkauft oder nur ein kleiner Rest übrig war, wurde alles wieder auf den Wagen geladen. Die Priebrower Fischer gingen in den Gasthof, tranken einen „Koks“ oder Bier. Der Koks bestand aus einem Schnapsglas Rum mit Kaffeebohnen. Ich bekam auch einen und merkte sehr seine Wirkung auf der Heimfahrt.
Getreideernte
Der Boden um Priebrow herum war leicht, geeignet für den Anbau von Roggen und Kartoffeln. Für Runkelrüben wurden Wiesenstücke auf schwarzem Boden umgebrochen. Fast jeder Hof hatte ein paar Spargelbeete, Wilhelm Ewald ein ganzes Spargelfeld.
Zur Erntezeit, meist in den großen Ferien, mussten die Roggenfelder mit der Sense angemäht werden, um die Mähmaschine einsetzen zu können. Hinter Onkel Albert nahm Tante Frieda die Halme auf, hinter meinem Schnitt mit nicht so glatt liegenden Halmen meine Cousine Hilde. An die Grasmähmaschine war ein Ableger montiert, worauf der Schnitt bis zur Garbendicke gesammelt und per Hand von einer zweiten Person auf einem nachmontiertem Sitz mit einer großen Harke abgelegt wurde. Die Garben banden andere Leute und stellten sie zu „Mandeln“ auf. Nach der Trocknungszeit wurden die Garben auf Leiterwagen geladen zur Fahrt in die Scheunen am Dorfrand. Das Dreschen des Getreides fand vorzugsweise im November oder Dezember statt. Zu meiner Zeit kamen Lohndrescher aus Sonnenburg mit großem Dreschkasten und Strohpresse. Früher wurde auf der Scheunentenne mit Dreschflegeln oder mit kleinen Dreschkasten gedroschen. Diese trieb ein „Rosswerk“ an. Dazu liefen die Pferde am „Tummelbaum” im Kreise. So häckselte man auf einigen Höfen noch bis Kriegsende. Wenn ich bei Tante und Onkel erschien hieß es oft: „Lass uns mal häckseln.“ Dann musste ich die Pferde aufschirren und am Tummelbaum treiben.
Hochwasser
Im Herbst gab es nach starken Regenfällen in Polen und in Schlesien oft Hochwasser. Die Wiesen vom Herrenwerder Deich bis Küstrin waren überschwemmt und Fischer stellten Netze auf ihren Wiesen aus. Sie waren etwa 20 Meter lang und zwischen in den Grund gesteckte Stangen mit oberer und unterer Reep gespannt. Zwischen zwei Reepen befand sich aus dünnem Garn großmaschiges, bauchiges Netz. Darin verfingen sich die Fische. Mit Onkel und Tante habe ich oft Netze gepuhlt, um sie für neuen Einsatz herzurichten. Am Nachmittag sind wir mit dem Kahn auf die Wiesen gefahren und haben die Netze in langen Reihen gestellt. Es war spannend und aufregend, wenn im Morgengrauen das Netz am oberen Reep in den Kahngezogen wurde und zappelnde Fische sich verfangen hatten. Sie wurden aus dem Netz genommen und ins Kahnfischfach gesetzt. Nach der Rückkehr gab es ein kräftiges Frühstück.
Großvater hatte mir sein Segel geschenkt. Die Fischerkähne waren nicht gut zum Segeln geeignet. Trotzdem hatte ich große Freude beim Segeln zwischen Priebrow und Küstrin. Wenn das Hochwasser über Winter blieb und gefror, hatten wir eine große Fläche zum Schlittschuhlaufen. Den Eltern mussten wir versprechen, nicht auf dem Fließwasser, dem Strom, zu laufen, wegen der möglichen offenen Stellen. Aus Weidenzweigen machten wir uns Hockeyschläger. Als Puck diente ein alter Schuhabsatz oder ein Holzstück. Es war unser großes Wintervergnügen.

Foto: Max Bläsing
Mit Verwendung von 3 Schlittschuhen und zwei dicken Brettern und Großvaters Segel habe ich mir einen primitiven Eissegelschlitten gebaut. Der hat mir viel Freude gemacht.
Ausbleibendes Hochwasser und Kahlfrost im Dezember brachten uns Spiegeleis. Mit der Eisaxt prüften die Fischer die Tragfähigkeit des Eises. Man ließ die Axt an ihrem langen Stiel mit der Rückseite aus Mannshöhe auf das Eis fallen. Schlug die stumpfe Axtseite bis zum Wasser durch, trug das Eis nicht. Nach der ersten Eisbildung standen Hechte manchmal dicht unter dem Eis. Wenn das Eis dann gerade trug, konnte man den Hecht mit einigem Geschick „deven“. Man näherte sich ihm vorsichtig und schlug mit der stumpfen Axtseite dem Hecht auf den Kopf. Das betäubte ihn für kurze Zeit. Schnell wurde ein dreieckiges Loch ins Eis geschlagen und der Hecht entnommen.
Lag des Eis schon längere Zeit, war Gelegenheit mit dem Zugnetz, der „Briese“ zu fischen. Im Abstand von etwa 3 Metern wurden dreieckige Löcher ins Eis geschlagen entlang des Weges, den die Flügel der Briese gezogen werden sollten. Eine dünne Stange unter dem Eise, mit Astgabeln von Loch zu Loch geschoben, transportierte die Zugleinen zum Endpunkt des Zuges. Mit diesen Leinen zog man die Briese bis an das größere Endloch. Hier kam sie aufs Eis und mir ihr die gefangene Fische. Abgefischt wurden auf diese Weise die stehenden Gewässer.
Fastnacht
Zur Fastnacht war „Bratwurstsingen“ angesagt. Dazu nahmen wir einen Weidenast mit vielen Seitenzweigen. Die Rinde schälten wir ab und hatten so unser Bratwurstspieß. Damit zogen wir von Haus zu Haus und sagten unsere Verse auf Einer davon lautete: „Bratwurst, Bratwurst, oben in der Ferste (First) hängen drei Bratwärste, gib mir die lange, lass die kurze hange, Schweinekopp, Schweinekopp ist besser als ne Bratwurst.“
Wir bekamen Wurst- und Speckstücke, Berliner, Brezeln und was sich als Gabe aufspießen ließ.
Die Erwachsenen hatten in dieser Zeit ihre Maskeraden. Da war ein großes Besorgen, Nähen, Basteln und heimliches Tun in Gange. Überwiegend die Frauen maskierten sich. Ihr Ziel war, vor der Demaskierung nicht erkannt zu werden. Ich war für eine Teilnahme noch zu jung. Meine Eltern und Verwandten hatten einen großen Spaß dabei.

Foto: Sammlung Helmuth Nultsch
Blieb das Hochwasser bis zum Frühling auf den Wiesen, begann das Sammeln der Bleßhühnereier (Krittscheleneier) in den aus dem Wasser ragenden Weidensträuchern. Bei Legebeginn waren bis 5 Eier unbebrütet. Drehte das Ei mit seinem dicken Ende auf der Hand unter Wasser noch oben, war es angebrütet. Diese Eier bekamen die Kälber in die Milch. Davon bekamen die ein seidiges Fell. Die nicht bebrüteten Eier schmeckten sehr gut und wurden auch zum Backen von Plätzchen verwendet.
Meine Eltern und Verwandten erzählten mit folgende Begebenheit:
Mitten auf unserem Hof stand an der Stirnseite des Viehstalles eine sehr alte Ulme, bei uns auch Rüster genannt. Ein Blitzschlag hatte die Baumkrone zerstört. Auf den Kronenrest wurde flach ein Wagenrad gelegt. Störche nahmen das zum Nestbau an. In den Jahren um 1925 baute mein Vater sein erstes Radio. Die Antenne war quer über den Hof gespannt. Ein Jungstorch hatte sich darin verfangen und war mit gebrochenem Bein abgestürzt. Meine Mutter hat dem Storch das Bein mit kleinen Holzstäben geschient und über Winter in der Häckselkammer versorgt. Statt Frösche musste er Fischteile fressen. Als die Altstörche im Frühjahr zurückkehrten, wurde er freigelassen. Er gesellte sich zu ihnen. Wir verloren ihn aus den Augen. Als Einzelstorch hatte er weder Partner noch Partnerin.
Zu Lebzeiten meiner Mutter schlug fünf Mal ein Blitz in die Gebäude ein, ohne größeren Schaden anzurichten. Nach dem letzten Blitzeinschlag 1929, dessen Folgen ich am nächsten Tage sehen konnte, montierte mein Vater auf dem Wohnhause einen Blitzableiter.
1923 wurde ich in Priebrow im Altenteilerhaus auf dem Hof meines Großvaters geboren. Dort habe ich meine Kindheit bis 1929 erlebt. Dann zog meine Familie nach das 1,5 km entfernte Sonnenburg. Hier hatte ich meine Schulzeit von 1930 bis 38 und anschließend die Maschinenschlosserlehre in der Sonnenburger Seidenfabrik. Danach ein Jahr Dienstverpflichtung auf dem Luftwaffenfliegerhorst in Königsberg/Neumark und anschließend Soldat. Bis zum Kriegsende habe ich meine Heimat nur in einigen Urlauben wiedergesehen. Ich habe gute Erinnerungen an Sonnenburg und Priebrow. Seit 1992 war ich mehrmals dort und hoffe, dass es nicht die letzten Besuche waren.
Bernhard Poteracki