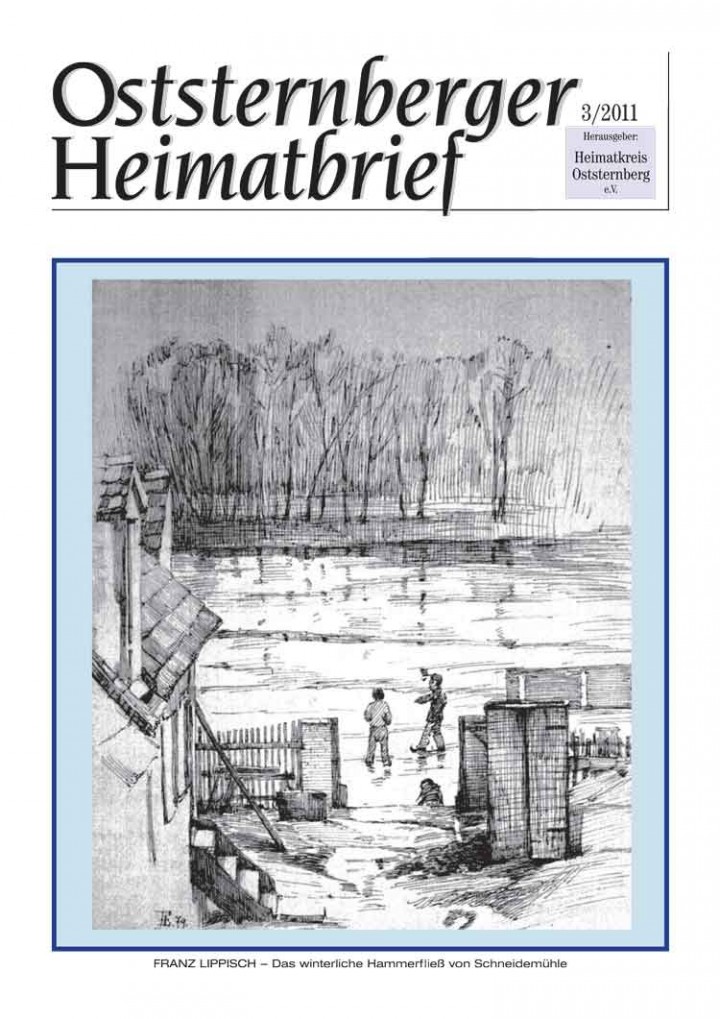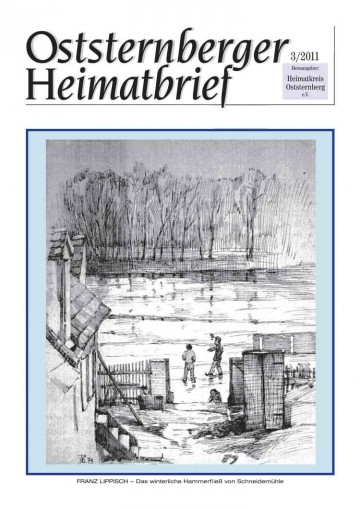Aus der Neumark in die Altmark– Teil 4
Bericht über eine geglückte unglückliche Flucht
Von Hagen Stein
– gering gekürzt –
Vorbemerkung
Dieser Erinnerungsbericht von Herrn Hagen Stein hat ein großes Interesse bei vielen Lesern geweckt. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, wiederum weitere Kapitel aus dem rund 30 Seiten umfassenden Bericht zu veröffentlichen. Die Redaktion und der Vorstand des HK danken Herrn Stein für die Freigabe.
Wohin weiter?
Alle Verwandten wohnten östlich der Oder!
Hinter einer großen, erhöht liegenden Schule müssen wir aussteigen. Die Frauen verabschieden sich teils überschäumend, teils still vom Fahrer. Er muss nun wieder in das entsetzliche Grauen, in die dauernde Gefahr zurück. „Kommt gut durch!“, lautet deshalb der gegenseitige Wunsch.
Im Sammelpunkt für Geflüchtete herrschen große Geschäftigkeit und eine erkennbar straffe Organisation. Ist man registriert, können Tee, Essen und Schlafplätze eingenommen werden. Aber nicht mit unserer Mutter! Nach einem Blick auf den taumelnden Ingo wird zuerst gierig getrunken, dann wird der Rotkreuzausweis zur schnellen Beschaffung einiger Tabletten benutzt. Das Essen entfällt, da wir in dem Stroh, das auf dem Fußboden und auf zusammengeschobenen Tischen ausgebreitet ist, schon zitternd und kraftlos eingeschlafen sind.
Von jenseits der Oder zucken hinter der Verdunklung grollend die Blitze der Abschüsse und Einschläge. Ich werde von schrecklichen Träumen über die vergangenen Tage mehrmals schweißgebadet wach, taste nach meinen Geschwistern und sehe glückserfüllt endlich auch meine Mutter im Halbdunkel neben dem fieberglühenden Ingo liegen. Sofort kommt sie mit dem Kopf hoch und befiehlt: „Schlaf!“. Ach, meine tapfere Mutti! Du darfst alles befehlen, wenn du nur bei uns bist! Selbst das heimliche Lesen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke würde ich unterlassen!
Wir verdösen den nächsten Vormittag im Gedränge der vielen mutlosen Geflohenen und freuen uns, dass unser Kranker deutliche Anzeichen von Besserung zeigt.
Meine Mutter berät mit mir, was wir nun unternehmen könnten. Ihre Schwester, deren inzwischen gefallener Mann aus Mitteldeutschland stammt, hatte dessen Heimatanschrift als äußerste Notfalladresse verteilt, doch der Zettel liegt irgendwo bei unseren verlorenen Habseligkeiten jenseits der Oder. Ich bin ganz sicher, dass das Wort „Altmark“ darin vorkam, da mich die mit unserer „Neumark“ identische Postleitzahl 19b überrascht hatte. Der ominöse Flüchtlingstransport soll genau in diese Richtung gehen. Wieder einmal Glück gehabt?
Beinahe wären wir einmal bis ans Ziel gekommen
Nachmittags erfahren wir, dass gegen Abend der Zug bereit gestellt werden wird. Zum vereinbarten Zeitpunkt, es ist bereits dunkel, werden wir durch die Stadt und dann durch Schrebergärten geführt. Es ist ein beklemmender Marsch zwischen den völlig schwarz wirkenden Häusern, deren Umrisse man nur sekundenlang gegen die östlich zuckenden Explosionen und Brände wahrnehmen kann. Vermutlich marschieren wir inmitten mehrerer Hundert angstvoll keuchender Menschen mit zum Teil mächtigen Gepäckstücken, Kinderwagen, Fahrrädern und Handwagen.
Wir gelangen an einen Bahndamm, der zur Oderseite durch einen Hang geschützt zu sein scheint, und erkennen in blauem Licht hoch über uns die Trittbretter von Schnellzugwagen und hinter den verdunkelten Scheiben, mehr zu ahnen als zu sehen, die Gesichter der Glücklichen, die es schon geschafft haben. Verflixt, unsere im Vergleich zu den Kräften schwere Habe und die beiden im Dunkel gegen die überholenden Drängler zu schützenden Kleinen haben uns ins Hintertreffen geraten lassen! Nun schleppen wir uns und unseren immer schwerer werdenden Koffer das Schotterbett entlang, doch wo auch immer wir fragen — von oben flüstern zitternde Frauenstimmen: „Alles voll!“
Meine Schwester beginnt zu schluchzen, und gerade will ich einstimmen, als bei den letzten Wagen von oben eine kräftige Männerstimme ertönt: „Hier ist besetzt!“. Ein Mann? Kurzer Disput, ob man nicht wenigstens nachsehen könne, ein selbstsicheres „Meinetwegen! Wenn Sie noch Platz sehen!“, schon erklimmt unsere Mutter den Wagen. Eine Taschenlampe flammt kurz auf. Wo hat Mutti die nun schon wieder so schnell mitgehen lassen!? Sofort ruft es barsch von allen Seiten: „Funzel aus!“ Alle haben natürlich Angst, dass der Zug in letzter Minute noch unter Beschuss geraten könnte.
Wir drücken uns glücklich an die Wand und in die ebenfalls vollgestellte Ziehharmonika. Außer uns kommen noch weitere erleichtert japsende Kinder und Frauen an Bord. Dann wird laut und mit Beifall aus den Abteilen gerufen: „Wir machen Platz für Kinder! Gehen sie das Vaterland verteidigen, sie alter Goldfasan!“ Wieder werden drei oder vier große Koffer hinabgestürzt und nochmals einige Personen heraufgezogen.
Als der Zug sich in Bewegung setzt, erkennen wir undeutlich im flackernden Licht der Explosionen ein Gewirr von Koffern, Bündeln, Kinderwagen und Fahrrädern, das am Bahndamm zurückbleiben muss.
Nun sortieren die Mütter die Gepäckstücke, um den kleinen Kindern, von denen unablässig einige weinen, eine Fläche zum Liegen zu geben. Koffer werden auf den Boden gelegt, die Gepäcknetze werden zum Schlafen benutzt. Wir werden wegen des Einsatzes unserer Mutter und des fiebernden Ingo mit besonderer Milde behandelt, so dass wir wenigstens eine Abteilseite gemeinsam haben und immer einmal die Hand unserer Mutter streicheln können. Ich habe einen halben Sitzplatz, von dem aus ich an der Verdunklung vorbei nach draußen blicken kann. Es ist sehr eng, bald schmerzen alle Gelenke vom Bewegungsmangel und vor Müdigkeit. Doch die Gewissheit, sich mit jeder Minute von den Orten des Schreckens und der Gefahr zu entfernen, lässt die Meisten erleichtert wach bleiben.
Während der nächtlichen Fahrt stellt sich heraus, dass dem Zug außer ein paar Rotkreuzhelferinnen ein Kommandant zugeordnet ist. Er schaut mit besorgter Miene auf meinen fiebernden Bruder, der inzwischen rote Flecke im Gesicht und am Hals bekommen hat. Vermutlich eine Folge der Medikamente; denn gegenüber den Vortagen geht es ihm eher besser, was wir am Essen erkennen konnten. Doch anscheinend befürchtet der Offizier, aus dessen linkem Ärmel eine Lederhand schaut, eine höchst ansteckende Krankheit und die Verseuchung des ganzen Transports. Er teilt mit, uns den Behörden des Ortes übergeben zu müssen, wo der Zug heute Nacht einige Stunden stehen bleibt.
Hat auch unsere müde Mutter Angst, die anderen Kinder zu gefährden? War es die Aussicht auf ein richtiges Bett? Die Hoffnung auf Ausschlafen? Oder einfach die Erschöpfung? Jedenfalls widerspricht sie nicht, und wir Kinder wissen ohnehin, dass sie immer das Richtige machen würde. Auch wenn uns nun knapp 200 Kilometer vor dem eigentlichen, wenngleich verschwommenen Ziel eine Unterbrechung verordnet wird.
Dallgow-Döberitz, Februar 1945
Die angeordnete neue Bleibe erweist sich als wenig friedvoll und lehrt uns neue Formen der Angst
„Dallgow-Döberitz” vermittelt uns ein Bahnhofsschild. Wir haben den Namen noch nie gehört, sonst hätten wir vielleicht gewusst, dass er vor allem den Militärs bekannt ist: Der Wehrmacht als großer Truppenübungsplatz, den Alliierten als Teil des Flakgürtels von Berlin. Mit einem Sanitätsauto, in dem meine Brüder trotz nur kurzer Fahrt sofort einschlafen, werden wir durch die Dunkelheit zu einem Einfamilienhaus gebracht. Eine unglaublich hilfreiche Familie, die zu dieser späten Stunde sicherlich geweckt werden musste, schiebt uns in zwei Zimmer unter dem Dach, wo wir vier bezogene, richtige Betten sehen.
Schnell bin ich mit dem Lösen der Schnürsenkel beschäftigt, da ertönt das schrille Geheul von Sirenen ganz aus der Nähe! Fliegeralarm! Ich weiß nicht, ob es Tränen der Wut oder der Angst sind, aber ich muss einfach losheulen. Unsere Wirtsleute, die wir erst seit wenigen Minuten kennen, klären uns auf, wo links nach 120 Metern der Luftschutzkeller für die ganze Straße ist, am Haus stehe groß „LSR“.
Minuten später stolpern wir, von neuer Angst erfüllt und vor Müdigkeit und Grauen zitternd, durch die von Lichtfingern der Scheinwerfer, donnernden Abschüssen der Flak, Leuchtkugeln, Explosionen am Himmel und lautem Flugzeuggebrumm zerschnittene Nachtluft. Dies wirkt auf so andere Weise als bisher schrecklich, dass uns das Weinen im Halse stecken bleibt.
Wir rennen!
Ich möchte es einfach nicht glauben, dass wir schon wieder durch eine so grelle und lärmerfüllte, lebensfeindliche Wirklichkeit hasten müssen. Wie lange geht denn das schon Drei-Vier taumelnde Kinder und eine drängende, mutmachende Mutter, in unbeschreiblicher Angst vor den ohrenbetäubenden Blitzen, von denen die Bedrohung ausgeht, die ihnen aber zugleich die einzige Chance geben, sich in der Finsternis und der unbekannten Gegend nicht zu verlieren. Als Letzte stolpern wir atemlos eine Kellertreppe hinunter. Hier sind wir sicher!
Der Luftschutzraum ist ein normaler, mit Holzbalken und Stützen zusätzlich ausgesteifter Keller. Es sind sehr viele Menschen, vielleicht 25 an der Zahl darin, teils sitzend, teils stehend. Man beruhigt uns Neulinge mit der Mitteilung, das Ziel der Bomber sei Berlin, hier müsse man eigentlich nur wegen der Flaksplitter Schutz suchen.
Doch da erschüttern einige gewaltige Detonationen den Keller, das Licht flackert, Putz rieselt von der Decke. Sofort ertönen Angstschreie, jemand kreischt: „Ich will hier raus!“ „Ruhe! Ruhe!“, ruft eine kräftige Stimme in das Wimmern von Kindern. Ich spüre wieder meinen dicken Angstkloß im Hals, aber dann glaube ich einfach nicht, dass dies wirklich ist. Was haben wir denn verbrochen, dass wir nun schon seit Tagen von Grauen zu Grauen gejagt werden? Nein, es ist nicht wahr!
„Die sollen aufhören, Mutti!“, schluchzt mein jüngster Bruder wieder, wie vor unendlichen Zeiten unter dem Bett in Neu-Bischofsee. Doch heute bleibt das Wunder aus. Erneut schlägt es krachend in der Nähe ein, der ganze Keller scheint zu fliegen, das Licht flackert mehrmals auf und bleibt dann aus. Im Schein der sofort aufflammenden Taschenlampen sieht und schmeckt man den trockenen Staub, der aus allen Fugen gerieselt zu sein scheint. Bleiche Gesichter und ängstliches Schweigen, Schluchzen und Kinderweinen. Meine Hand am Stützpfeiler spürt das knarrende Seufzen des Holzes. Ob es halten wird?
Ein Schrei „Platz da! Lasst mich raus!“, Bewegung in der Wand aus Körpern. Da ist ein Mann durchgedreht und will nun unseren kranken Bruder, der auf einem Holzklotz sitzt, zur Seite drücken oder gar überrennen! Woher hat Mutti diesen Schimpfwortschatz? Woher den Mut zu Faustschlägen und Fußtritten? Schnell hat sie Unterstützung, der Panikmacher wird auf eine Bank gedrückt und dort bis zur Entwarnung festgehalten.
Noch lange bebt unsere Mutter vor Zorn, weist jede Anrede und unser dankbares Streicheln brüsk zurück, stammelt nur „Ach, lasst…!“. Und dann weint sie, und wir alle weinen mit. Wir ahnen mehr als wir wissen, dass sie fürchtet, irgendwann für eines ihrer Kinder zu spät zu kommen oder am falschen Platz zu stehen. Wie soll jemand in diesen täglich neuen Bedrohungen immer den richtigen Moment zum Weglaufen erkennen? Nun ist auch sie am Ende ihrer Kraft!
Die Hauswirtin klärt uns auf, dass – wohl von einem Notabwurf – das Kino und die Schule getroffen worden sind. Vielleicht könnten wir den Handwagen nehmen und aus den Trümmern, natürlich vorsichtig und ganz am Rand, Holzreste und kleine Balken ziehen. Als Brennholz. Und wir sollten nicht zum Bahnhof gehen; denn dort seien – wie man hört – die letzten Wagen eines Flüchtlingszuges getroffen worden. Einige Kinder und Frauen sind ums Leben gekommen, viele verletzt.
Wir hören erschreckt zu und trauen unseren Ohren nicht! Unser Zug! Unser kranker Bruder, das Sorgenkind, die Nervensäge, hat sich als Schutzengel erwiesen. Und die übermüdeten Frauen, die uns wegen des zwangsweisen Ausstiegs vor dem Ziel bedauert hatten, sind nun…? Wieder einmal: Nicht daran denken! Erneut hat uns ein Zufall gerettet? Nein, unsere Mutter hat einfach alles richtig gemacht! Wie immer!

Später werden die beiden ersten Februarwochen, in denen wir uns befinden, in der Geschichte des Luftkrieges als heftigste Angriffsphase auf Berlin gelten. Beinahe Tag und Nacht heulen die Sirenen, das belfernde Krachen der Flak drückt schier ununterbrochen auf unsere Ohren. Nur noch ein einziges Mal rennen wir in den Luftschutzkeller, wo spürbare Angst wieder eine unerträgliche Spannung erzeugt. Dann schließen wir uns dem älteren Ehepaar an, das auf dem Nachbargrundstück eine Laube bewohnt. Die Beiden gehen schon lange nicht mehr in den Keller, sondern bleiben bei jedem Alarm eng umschlungen sitzen. Entweder werden es beide überleben oder sie sterben gemeinsam. Nun setzen wir uns allnächtlich dazu, halten uns an den Händen und ertragen zitternd das laute Flakfeuer und auch die seltenen, glücklicherweise meist sehr entfernten Einschläge.
Einmal sind wir etwas zu langsam beim Ortswechsel, da wir die letzen Häppchen des Abendessens nicht liegen lassen wollen. Ein Einschlag in der Nähe lässt mir einen großen Brocken Putz in den Nacken klatschen, so dass ich voller Panik sekundenlang glaube, das Haus stürzt ein. Zugleich höre ich meinen Bruder herzbrechend aufschreien. Er ist von der Druckwelle nach vorn geschleudert worden und hat sich mit beiden Händen auf die vom Abendessen noch heißen Kochplatten abgestützt.
Kaum von der schweren Grippe genesen, hat er nun zwei verbrannte Handinnenflächen und große Schmerzen. Es wird wirklich Zeit, dass wir diesen Ort verlassen!
Auch in der Laube haben wir noch immer schreckliche Angst. Wir fordern das Schicksal heraus – das kann doch nicht ewig gut gehen! Aber wenigstens ist die hysterische Atmosphäre des engen Luftschutzraumes fern. Außerdem sind wir alle ganz nah an unserer Mutter.