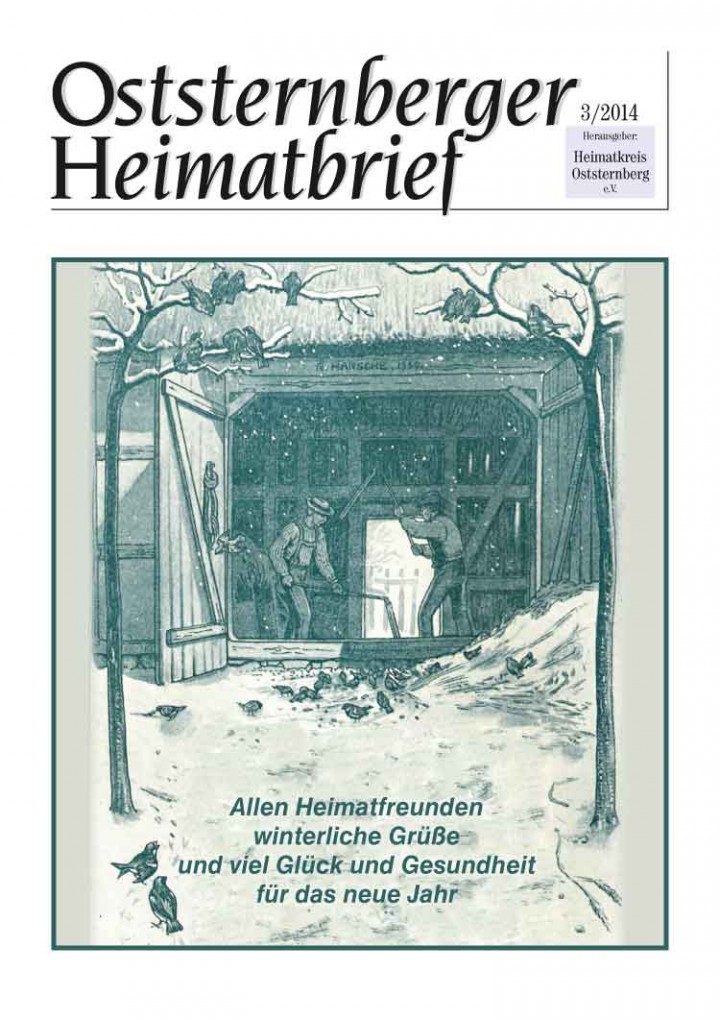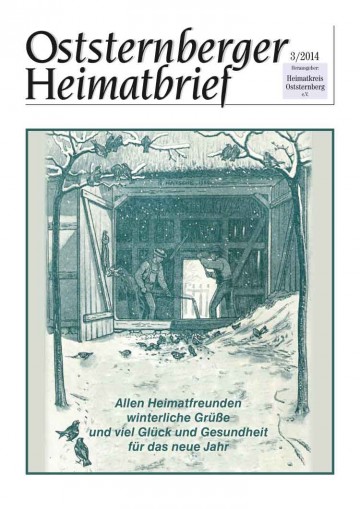Auszüge aus handschriftlichen Aufzeichnungen von Rosemarie Borchardt aus Wallwitz aus den Jahren 1951/52
Sie beginnen Ostern 1945. In russischer Gefangenschaft.
Teil 1
Seit dem 1. Februar waren die Russen in Wallwitz. Ende März, Anfang April drängte eigentlich die Frühjahrsbestellung. Frauen und Mädchen wurden von den Russen zur Arbeit geholt, aber nicht etwa zur Feldarbeit, denn es gab ja viel Wichtigeres zu tun! Schützengräben und Tarnlöcher für Lastwagen mussten wir schaufeln. Auch Häuser, Stallungen und Höfe mussten erst mal ‚kultiviert‘ werden! So wurden beispielsweise Kuhställe nach dem Ausmisten mit Kies ausgefahren! Also fuhren meine Schwester und ich am Karfreitag und Ostersonntag Mist. Vieh gab es ja sowieso nicht mehr.
Am Ostersonnabend erschien im Dorf ein kleiner Lastwagen der GPU. Die Kommissare mit den grünen Deckelmützen suchten sich ein paar harmlose BDM-Mädchen aus dem Dorf und fuhren mit ihnen fort. Der Sonntag verlief ziemlich ruhig. Sogar einen Osterkuchen hatten wir uns heimlich gebacken. Am zweiten Feiertag, dem 2. April 1945, als wir zum Essen nach Hause gingen, hielt abermals dieses verdächtige GPU-Auto im Dorf. Nachdem wir vom Essen kamen, fuhr unser kleiner russischer Aufseher mit einer weiblichen Arbeitskolonne auf seinem Lastwagen zu einer Kiesgrube in Missgunst, und wir luden Kies. Unser netter Aufseher zögerte die Heimfahrt endlos hinaus. Er schien zu wissen, was uns vielleicht bevorstand, wenn wir der GPU noch begegneten. Am späten Nachmittag mussten wir wohl oder übel ins Dorf zurück. Dort lief uns unser kleiner Bruder schon entgegen und teilte uns mit: „Ihr sollt sieben Tage zur Arbeit!„ Mutter erwartete uns schon in heller Aufregung. Sie hatte uns ein paar Sachen zusammengepackt. Decke und Verpflegung für zwei Tage war mitzubringen. Hastig aßen und tranken wir noch etwas, und dann war auch schon ein Posten da, um uns abzuholen. Mit einigen anderen Frauen und Mädchen aus dem Dorf bestiegen wir die Ladefläche des kleine Autos. Bald lag Wallwitz hinter uns, das uns eine sorglose, himmlische Heimat gewesen war. Es dämmerte schon. Eine andere Ortschaft, durch die wir fuhren, war leer und total ausgeplündert. Alle Häuser boten einen jämmerlichen Anblick. Schließlich gelangten wir nach Sternberg. Hier mussten Kämpfe stattgefunden haben, überall Schutt und Asche. Kaum konnten wir feststellen, wo genau wir uns befanden. Unser Auto hielt schließlich vor einem leidlich heilen Haus in der Crossener Straße.
Wir wurden in einen engen Korridor geführt und mussten warten. Alles war unheimlich. Unter anderen Umständen hätten wir all das wohl als ein romantisches, wenn auch etwas grusliges Abenteuer angesehen, aber es war kein Spaß. Nacheinander wurden wir aufgerufen, wir beiden Schwestern gemeinsam. In einem hellen Raum saß ein russischer Leutnant am Tisch, neben ihm stand eine Dolmetscherin. Es sah sehr amtlich aus. Alle Sachen nahmen sie uns ab. Nur die Decke, einen Löffel und unser Brot durften wir behalten. Auch den Inhalt unserer Kleidertaschen mussten wir vorzeigen. All meine Fotografien und Papierchen wurden genau registriert, und ich musste sie abgeben. Zum Schluss musste jeder seine Unterschrift unter ein russisches Schriftstück setzen. Wir hatten keine Ahnung, was wir da unterschrieben. Natürlich hatten wir größte Bedenken, dass wir uns damit lebenslänglich nach Russland verpflichten oder ähnliches. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, führte uns der Posten eine dunkle, halsbrecherische Steintreppe hinab, über einen schmutzigen Hof in einen dumpfen, muffigen Keller. Hier lagen schon mehrere Leidensgefährtinnen auf Stroh. Es war so eng, dass wir kaum alle Platz hatten. Doch wir kamen nicht zur Ruhe, denn erst mussten alle Vermutungen ausgetauscht werden, bis schließlich der Posten zur Ruhe mahnte. Trotzdem war kaum an Schlaf zu denken. Nach einer recht unerquicklichen Nacht schaute ein neuer trüber Morgen durch die winzige Kellerluke. Immer zu zweit durften wir uns draußen an der Pumpe waschen. Die Verpflegung war reichlich und verhältnismäßig gut, wenigstens erschien uns das so, denn Appetit hatte eigentlich keiner. Die Tür zur Außenwelt war leider meist geschlossen, und der Posten draußen gab uns den wohlgemeinten Rat: „Schloafen!„ So vergingen einige Tage.
Zum Glück avancierte ich oben beim Koch zum Küchenmädchen. Wannenweise schüttete ich Essen fort, das in Fett schwamm. So ging es mir unvergleichlich viel besser als meinen Kameradinnen unten im Keller. Der Koch mochte mich gut leiden, und ich erhielt hier und da einen Extraleckerbissen. Einmal sollte ich Brot schneiden und schnitt mir dabei ganz gewaltig in den Daumen. Alle sehnten wir den Tag herbei, an dem wir diesen scheußlichen Ort verlassen könnten. Wahre Schauermärchen machten die Runde. Eine Dolmetscherin vertraute mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit an, dass wir alle nach Sibirien verladen werden sollen.
Eines Nachts begannen Verhöre. Einzeln wurden wir mitten in der Nacht nach oben geholt. Der Leutnant befragte uns über Dinge, die den Russen längst bekannt waren, z.B. wie viel Morgen Land, wie viele Angestellte und wie viel Vieh wir besaßen, wie viel Ausländer bei uns beschäftigt waren, ob Vater in der Partei war und ähnliches mehr.
Wieder war es Sonntag. Unerwartet erhielten wir alle unsere Sachen zurück. Einige Frauen durften nach Hause gehen. Wir übrigen mussten wieder ein Lastauto besteigen zu einer neuen Fahrt ins Ungewisse. Mit uns, also meiner Schwester und mir, waren aus Wallwitz noch eine ältere Frau, Frau Opitz, und zwei Mädchen unseres Alters, Else Sprenger und Eva Wothe, dabei. Unsere Reise endete in Schwiebus. Hier war die Welt im wahrsten Sinne des Wortes mit Brettern vernagelt. Auf einem fast endlosen, grauen Hof mussten wir an einer Mauer aufgereiht warten. Immer mehr Leidensgefährtinnen gesellten sich zu uns. In einem Schuppen wurden wir abermals in eine Liste eingetragen, und habgierige Russinnen revidierten unsere spärliche Habe. Einige von uns mussten sich den schamlosesten Leibesvisitationen unterziehen. Vom Schmuck bis zur Leibwäsche wurden alle besseren Gegenstände einkassiert. Später konnten wir sie an Russinnen oder Polinnen wiederentdecken. Dann ging es in das eigentliche Lager: hohe Bretterzäune (bis zu 3 m hoch), davor Stacheldraht, alle 30–40 m ein Wachturm mit einem bewaffneten Posten. Trostlose, mehr oder weniger in Lumpen gehüllte Gestalten, wohin man auch blickte. Wir wurden in eine Baracke geführt. Die Einrichtung des riesigen Raumes bestand aus zwei Bretterreihen an den Längswänden und einer in der Mitte etwa einen knappen Meter über dem Fußboden, darüber jeweils eine zweite Bretteretage. Das wurden unsere Lagerstätten. Etwa 300 Menschen wurden in dem Raum untergebracht. Wie lagen dicht an dicht wie die Heringe.
Von nun an wurden wir zu Herdenmenschen: Antreten zum Appell, antreten zum Waschen, zum Essenholen, ja selbst der Königsweg erfolgte in Reih und Glied unter Bewachung eines Russenmädchens. Die sogenannte Toilette bestand aus schwankenden Balken, die über einer offenen Grube lagen. Zur Desinfektion wurde ab und an Chlorkalk in die Grube geschüttet. Das Essen war miserabel. Aber wir waren noch nicht ausgehungert und aßen einfach nichts, wenn es ungenießbar schien. Das Männerlager grenzte direkt an unseres. So hielten wir immer wieder nach Vater Ausschau, der vier Wochen zuvor abgeholt worden war. Aber vergeblich! Es war quälend an ihn zu denken, wenn wir mitansahen, wie die Männer im Nachbarlager misshandelt und geschlagen wurden.
Dass von Waschen keine Rede war, hatte einen einfachen Grund. Auf dem Lagerhof gab es so eine Art Rinne mit Wasserhähnen drüber, aber die waren morgens meist zugefroren und reichten sowieso nicht für die vielen Menschen.
Hin und wieder kreisten einige deutsche Aufklärer über dem Lager, das unmittelbar neben Eisenbahngleisen lag, vielleicht sogar in der Nähe des Schwiebuser Bahnhofs, was wir aber nicht feststellen konnten. Die russische Eisenbahn-Flak schoss dann aus allen Rohren nach den Flugzeugen. Eines Abends, wir waren gerade auf dem Weg von der Toilette zurück zur Baracke, beobachteten wir begeistert, wie drei kleine deutsche Flugzeuge unbeirrt mitten durch das russische Feuer flogen. Zwei waren schon aus dem Feuerbereich heraus, als es im letzten Augenblick das dritte erwischte. Mit einer langen schwarzen Rauchfahne machte es eine scharfe Kurve und sauste direkt auf unser Lager zu. Wir konnten gerade noch hinter einer Barackenwand Schutz suchen, als uns unter Staub und Qualm alles um die Ohren flog. Rundherum nur blutende schreiende Gestalten. Mein erster Gedanke galt Ingrid, die in der Baracke zurückgeblieben war. Jede Lagerordnung war im Augenblick dahin, alles rannte und schrie durcheinander. Da kam mir plötzlich Ingrid kreideweiß entgegen und fiel mir mit dem erlösten Ruf: „Himmi!„ (mein Spitzname) in die Arme. Wie durch ein Wunder hatten wir beide nichts abbekommen, während unmittelbar neben mir eine Frau von zahlreichen Flugzeug- oder Flak-Splittern getroffen worden war. Als wir in die Baracke zurückkamen, blieb uns fast das Herz stehen. Genau auf dem kleinen Fleck, auf dem noch wenige Minuten zuvor mein Kopf gelegen hatte, lag ein dicker Balken, der das Dach gehalten hatte. Die ganze Barackenrückwand war abgerissen worden. Draußen wimmelten die Menschen wie Ameisen durcheinander, es hat viele Tote und Verwundete gegeben. Angst und Entsetzen ergriff uns, denn das Flugzeug war direkt in das angrenzende Lager gestürzt, in das wir in ein, zwei Tagen umziehen sollten. Durch den Umzug verschlechterten wir uns, obwohl die neuen Behausungen teilweise aus Stein gebaut waren. Aber sie hatten durch den Flugzeugabsturz keine Türen und Fenster mehr. Auch fehlten halbe Dächer. Es war furchtbar kalt, und wir froren entsetzlich. Welchen Zwecken diese Behausungen früher gedient hatten, konnten wir nicht herausfinden. Waschgelegenheiten waren nun auch gänzlich abgeschafft. Auf der Pritsche über uns hausten nun einige total verlauste Mädchen, und es setzte manchmal wahre Läuseregen, was für uns natürlich nicht ohne Folgen blieb. Zu allem Übel bekam ich auch noch eine kräftige Angina. Den täglichen Fraß konnte ich nun nicht mal mehr schlucken.
Neue Gerüchte gingen um. Angeblich sollten wir nur noch einmal registriert werden und dann nach Hause gehen dürfen. Natürlich kamen solche Nachrichten immer aus garantiert sicheren Quellen. Unsere Zuversicht stieg und wir schmiedeten bereits Pläne für den Heimweg. Tatsächlich mussten wir an einem Nachmittag Ende April „Antreten mit Gepäck„. Ich hatte grässliche Halsschmerzen, aber was tat das schon, es sollte ja nach Hause gehen. Wieder wurden wir alle aufgerufen und dann truppweise fortgeführt. Aber, o Schreck!, der Weg führte die Bahnböschung hinauf und geradewegs in einen dort stehenden Güterzug. Immer 90 Frauen und Mädchen wurden abgezählt und in einen Viehwagen gesperrt. All unsere Zuversicht war dahin, als hinter uns die Waggons fest verschlossen und plombiert wurden. In Richtung Westen wäre so eine Maßnahme wohl überflüssig gewesen! Es war furchtbar eng und nicht jede fand einen Sitzplatz. Also mussten wir uns abwechseln. Einen Abort gab es nicht. Statt dessen führte eine schmale Holzrinne zu einer winzigen Öffnung nach draußen.
Nach einigen Stunden Wartens, inzwischen war es dunkel geworden, wurde an den Zug eine Lokomotive angekoppelt. Bald darauf setzte sich der Zug in Bewegung, und er fuhr nach Osten. Unter Ruckeln und Stoßen schlich der Zug dahin. Ab und an ein Halt auf freier Strecke. Als der Morgen dämmerte, behaupteten einige Landeskundige, wir seien in der Gegend von Posen. Vor Staub im Wagen und vor Durst konnten wir kaum noch sprechen. Beim nächsten Halt wurden Lebensmittel und etwas Kaffee hereingereicht. Die Mittagssonne sengte auf das Pappdach des Waggons. Dann ruckte der Zug wieder an. Plötzlich kam ein Schrei vom Ausguck: „Wir fahren ja nach Westen!„ Kurze Zeit später schienen wir am Ziel zu sein, in Posen.
Dies soll der erste Transport gewesen sein, der nicht weiter nach Sibirien fuhr. Die Wagen wurden geöffnet und die herausquellenden Gefangenen in einem langen Zug weggeführt. Ich konnte kaum meinen leichten Rucksack tragen, so hatten mich Fieber, Durst und Hitze geschwächt. Aber auch den anderen ging es nicht viel besser. Mühsam schleppten wir uns dahin. Mitleidige Menschen am Wegrand schenkten uns Kaffee oder Wasser ein, aber nur heimlich, denn sonst setzte es Schläge von den russischen Bewachern.
… Fortsetzung in HB 1/2015