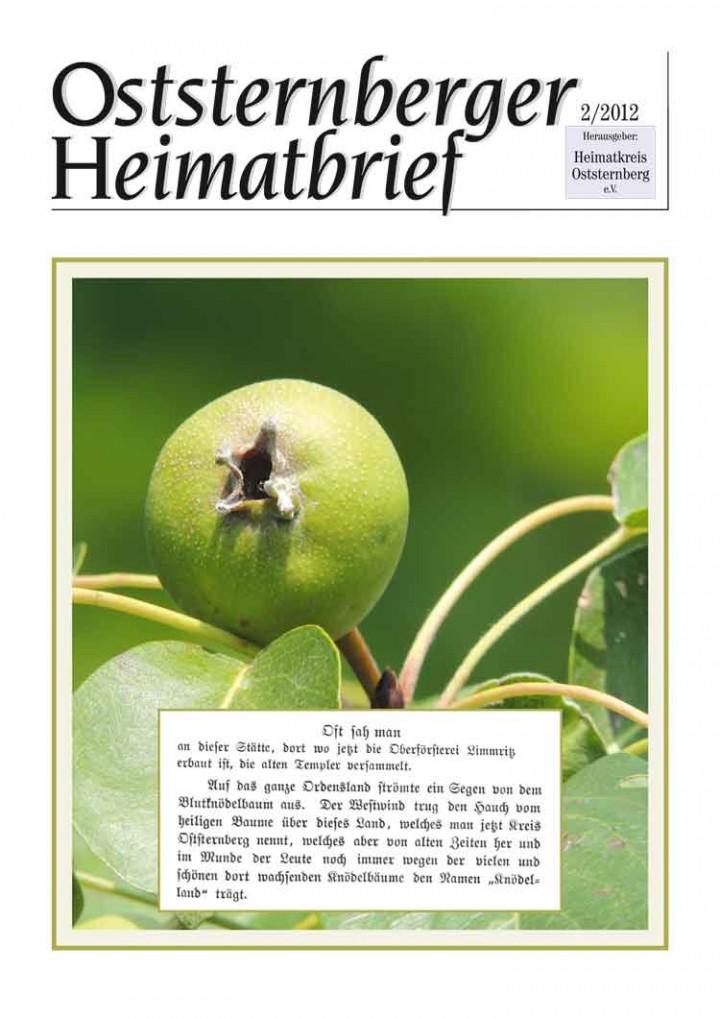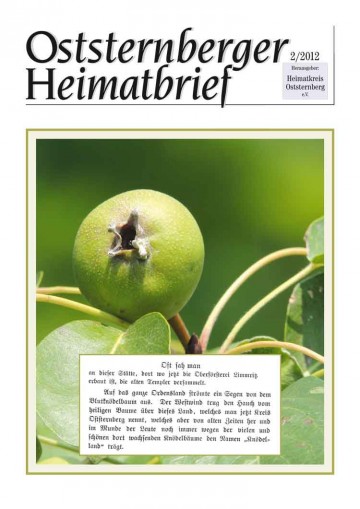Kindheitserinnerungen
Als ich Kind war, standen wir immer auf, wenn nachts ein Gewitter war. Wir zogen uns vollständig an. Meine Mutter hatte dann eine große Einholtasche, in der alle Sachen waren, die bei einem Feuer unbedingt gerettet werden mussten. Außerdem hatte auch noch jeder etwas Wichtiges in der Hand. Wenn das Gewitter abgezogen war, gingen wir hinaus, um zu sehen, wo es eingeschlagen hatte. Nach einem besonders heftigen Gewitter zählten wir einmal acht Brände, die wir von unserem Hof aus sehen konnten. Das war die höchste Zahl, an die ich mich erinnern kann, meistens waren es weniger oder gar keine.
Eine Geschichte wurde erzählt, für deren Wahrheitsgehalt ich aber nicht garantieren möchte: Als ein Gewitter aufzog, holte ein Kleinbauer sein Pferd aus dem Stall und band es draußen an. Der Nachbar fragte: „Warum bindest du das Pferd da an? Es gibt doch gleich ein Gewitter.“ Er antwortete: „Wenn der Blitz einschlägt und der Stall abbrennt, dann habe ich doch wenigstens das Pferd gerettet.“ Der Blitz schlug tatsächlich ein, und der Stall brannte ab.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden überall Blitzableiter gebaut. Anfangs gab es im Warthebruch auch noch viele Strohdächer. Sie wurden laufend weniger, da bei Neubauten, Umbauten und Reparaturen Dachziegel verwendet wurden. Mir ist auch kein Handwerker bekannt, der noch Strohdächer herstellen oder reparieren konnte.
Wenn ein Blitzableiter geerdet werden sollte, grub man ein Loch bis auf das Grundwasser und trieb dort einen eisernen Metallstab in den Boden hinein, sodass das Ende des Blitzableiters garantiert immer im Grundwasser war. Bei dem hohen Grundwasserspiegel des Warthebruchs ist das wohl fast überall der Fall gewesen.
Der Chef der Firma, die die Anlagen baute, war anscheinend vermögend. Er hatte in Landsberg Häuserblöcke mit Mietwohnungen gebaut, vermutlich um sein Geld wertbeständig anzulegen. Er hatte auch einen Bruder, der Alkoholiker war. Er rüstete den Bruder mit einem Messgerät aus, mit dem er feststellen konnte, ob die Blitzableiter richtig geerdet waren. Dafür kassierte er eine Gebühr. Von Beanstandungen habe ich nie etwas gehört. Es wurde erzählt, wenn er genug Geld kassiert hatte, ging er in die nächste Gastwirtschaft und setzte es in Alkohol um. So konnte er immer sehr früh Feierabend machen. Falls diese Geschichte nicht stimmt, ist sie doch zumindest gut erfunden.
Eine andere große Aktion war die Elektrifizierung des flachen Landes mit seinen Streusiedlungen. Bis dahin sah man auf jedem Bauernhof einen Göpel. Im Warthebruch sagte man Rosswerk dazu. Diese Rosswerke verschwanden sehr schnell, weil die landwirtschaftlichen Maschinen nun mit Elektromotoren angetrieben wurden.
Eine zentrale Wasserversorgung gab es im Bruch nicht. Auf jedem Hof stand eine Wasserpumpe. Das Pumpenwasser war von schlechter Qualität und war auch stark eisenhaltig. Die Eimer in der Küche, in denen Wasser vorrätig gehalten wurde, nahmen nach einiger Zeit eine rotbraune Farbe an. Das Pumpenwasser war weich, aber man trank Kaffee, selten Tee, während man sonst in Gegenden mit weichem Wasser wie Marschen, Halligen und Inseln vorwiegend Tee trinkt.
Zum Wäschewaschen benutzte man Regenwasser. Das Regenwasser vom Ziegeldach wurde in der Dachrinne ge-sammelt, die es in die Regentonne ableitete. Die Ziegeldächer waren nicht grundsätzlich mit Dachrinnen ausgerüstet, sondern die Dachrinne war jeweils nur so lang, wie es erforderlich war, um die nötige Menge an Regenwasser in der Tonne zu garantieren. Gehöfte, die unmittelbar an einem Bach oder Entwässerungskanal lagen, hatten häufig auch einen „Schöpfsteg“. Das war ein Holzsteg dicht über der Wasseroberfläche, von dem man mit einem Eimer Wasser schöpfen konnte, das man wie Regenwasser verbrauchte.
Anmerkung (Habermann): Der vorstehende Artikel entstammt dem (nicht veröffentlichten) Buch: „Verlorene Heimat Warthebruch“ von Dr. Willi Schlaak (14.3.1911-21.11.2004) aus Schartowsthal.